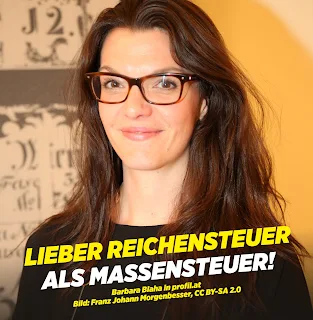Der durch den Cum-Ex-Skandal verursachte Steuerschaden in Österreich belief sich Schätzungen der an der Aufklärung des Falls maßgeblich beteiligten Rechercheplattform „Corrective“ zufolge auf etwa 1,2 Milliarden Euro. Weltweit wurden durch den Cum-Ex-Skandal und vergleichbare, steuergetriebene Aktiengeschäfte nach aktuellen journalistischen und wissenschaftlichen Schätzungen mindestens 150 Milliarden Euro an Steuern hinterzogen. Diese Zahl umfasst neben Cum-Ex auch Cum-Cum und ähnliche Modelle. Hanno Berger, der jahrzehntelang zu den renommiertesten Steuerrechtsanwälten der Bundesrepublik zählte, gilt als Initiator der CumEx-Geschäfte. Der Steuerbetrug erfolgte durch die missbräuchliche Mehrfacherstattung von Kapitalertragsteuer, auf die in dieser Form kein Anspruch bestand. Eigentlich sollten Cum-Ex-Geschäfte längst der Vergangenheit angehören, doch: Mit anderen Methoden läuft der Steuerbetrug weiter.
Der Schaden betrifft vor allem europäische Länder: Deutschland ist mit geschätzten 36 Milliarden Euro am stärksten betroffen, gefolgt von Frankreich mit 33,4 Milliarden Euro, den Niederlanden mit 27 Milliarden Euro, der Schweiz mit 4,8 Milliarden Euro und Österreich mit 1,2 Milliarden Euro. Aber auch weitere Staaten weltweit sind betroffen. Die genannten 150 Milliarden Euro gelten dabei als konservative Schätzung – der tatsächliche Gesamtschaden könnte also noch höher ausgefallen sein. Die Dimension dieses Steuerbetrugs ist damit weltweit beispiellos und hat weitreichende Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte vieler Länder.
Das österreichische Finanzministerium und der Rechnungshof beziffern den Schaden allerdings nur auf insgesamt 180 bis 187 Millionen Euro. Der Großteil dieses Betrags ist für den österreichischen Staat faktisch verloren. Bis August 2025 gibt es in diesem Fall keine rechtskräftigen Verurteilungen. Die WKStA hat jüngst ihre Ermittlungen im Cum-Ex-Skandal auf mittlerweile 30 Personen und 15 Unternehmen ausgedehnt.
Ein Interview mit Anne Brorhilker war der Anlass, wieder über diesen Fall zu berichten. Anne Brorhilker war Deutschlands bekannteste Cum-Ex-Staatsanwältin. Elf Jahre lang ermittelte sie federführend gegen Cum-Ex. Vor einem Jahr hörte sie auf, da sie am politischen Willen zur Aufklärung des Steuerskandals zweifelte, verzichtete auf ihr Beamtengehalt und ihre Pensionsansprüche und wechselte zur NGO Finanzwende. In diesem Artikel beschreibt sie die Anfänge der Cum-Ex-Ermittlungen und nennt auch diejenigen, die ihrer Meinung nach den Kampf gegen Finanzkriminalität behindern.
Weitere Infos und Quellen:
https://gruenebiedermannsdorf.blogspot.com/2018/11/cum-ex.html
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/news/news/aktuelles/Rechnungshof_veroeffentlicht_drei_Follow-up-Berichte.html
https://www.fondsprofessionell.at/news/maerkte/headline/cum-ex-skandal-45-verdaechtige-in-oesterreich-202057/
https://de.statista.com/infografik/26036/geschaetzter-steuerverlust-durch-cum-cum-und-cum-ex/
https://correctiv.org/top-stories/2021/10/21/cumex-files-2/
https://de.wikipedia.org/wiki/CumEx-Files